LNG erlebt derzeit einen wenig beachteten Boom als Kraftstoff für Schiffsantriebe. Schon in wenigen Jahren wird der Marktanteil auf 10 Prozent steigen und über 2000 große Seeschiffe versorgen. Klimapolitisch ist dieser Pfad jedoch eine Sackgasse.
Was ist LNG?
LNG ist tiefgekühltes, flüssiges Erdgas: Liquefied Natural Gas. Es besteht fast ausschließlich aus Methan (CH4). Da es im flüssigen Zustand deutlich weniger Volumen einnimmt (1:600), kann es mit speziellen LNG-Tankern auch über die Meere gehandelt werden.
LNG als Kraftstoff
Erdgas wird vor allem in der Industrie, im Stromsektor und in Gebäudeheizungen verbraucht. Aber auch als Kraftstoff im Verkehr wird es weltweit eingesetzt. Das gilt für PKW (CNG) und LKW (LNG) ebenso wie für Pipelines (Kompressorgas). Das soll jedoch Thema eines späteren Artikels werden.
In diesem Artikel geht es Einsatz von LNG als Kraftstoff im Seeverkehr.
Vorab noch ein Hinweis zur Terminologie: Kraftstoff und Treibstoff meinen im Verkehr dasselbe. Der englische Begriff Fuel ist etwas breiter, da er Kraftstoffe/Treibstoffe ebenso wie Brennstoffe bezeichnet, kann aber in unserem Kontext ebenso verwendet werden (aviation fuel, road fuel, bunker fuel, shipping fuel etc.).
Warum ist LNG als Shipping Fuel attraktiv?
LNG als Kraftstoff hat für die Reeder diverse Vorteile: Es ist in etwa genauso teuer und nicht selten sogar billiger als Dieselkraftstoffe, es ist in zahlreichen Häfen verfügbar, und es verbrennt vor allem deutlich sauberer.
Das erlaubt den Zugang zu Fahrtgebieten mit höheren Umweltanforderungen (ECA) und erspart andere Maßnahmen, um insbesondere die Anforderungen der neuen EU-Verordnung zum Klimaschutz im Seeverkehr einzuhalten (FuelEU Maritime 🔗 ).
Aus diesem Grund wird auch Bio-LNG von Reedern stark nachgefragt: LBM (Liquefied Biomethane). Die Mengen sind noch gering. Allerdings reichen schon geringe Beimischungen zum fossilen LNG, um alle Emissionsforderungen der EU bis weit in die 2030er Jahre hinein zu erfüllen.
Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Schiff LNG oder Bio-LNG eingesetzt wird. Entscheidend ist der Flottenverbrauch (Mass Balancing / Book & Claim). Wenn ein einzelnes Containerschiff mit LNG-Antrieb die EU-Anforderungen übererfüllt, können andere Schiffe der Flotte weiterhin konventionelle Kraftstoffe verwenden.
Die Mengen: Wieviel LNG wird als Kraftstoff im Seeverkehr verbraucht?
Wieviel LNG wird von Seeschiffen aktuell verbraucht? Dazu gibt es nur spärliche Informationen, die außerdem nicht immer zueinander passen. Da der Markt stürmisch wächst, sind ältere Informationen schnell überholt.
Laut IMO 🔗 , der UN-Organisation for die internationale Schifffahrt, wurden 2023 etwa 13 Mio. Tonnen LNG im Seeverkehr mit größeren Schiffen (> 5000 GT) verbraucht. Davon entfielen 90 Prozent auf LNG-Tanker, also Schiffe, die LNG als Fracht transportieren und gleichzeitig als Fuel verwenden.
Eine Menge von 1,3 Mio. Tonnen LNG (10 Prozent der Gesamtmenge) wurde im Jahr 2023 von anderen Schiffstypen eingesetzt, vor allem von Containerschiffen. Das ist nahezu eine Verdopplung gegenüber dem Jahr 2022 (0,7 Mio. t). Im Jahr 2024 und auch im aktuellen Jahr 2025 geht es weiter steil bergauf. Allein die beiden großen Bunker Ports Rotterdam und Singapur stellten im letzten Jahr 420.000 bzw. 460.000 Tonnen LNG bereit.
Abhängig von der Entwicklung der Ölpreise und der Gaspreise könnten im laufenden Jahr 2025 also bereits um die 2 Mio. Tonnen LNG erreicht werden, plus die Mengen, die in LNG-Tankern verbraucht werden. Auch hier wachsen die Mengen.
Davon abweichende Zahlen wurden vor wenigen Tagen von Shell präsentiert, wenn auch nur grafisch. In ihrem LNG Outlook 🔗 ist zu sehen, dass schon 2023 etwa 3 Mio. Tonnen LNG außerhalb des Segments der LNG-Tanker verbraucht wurden. Das ist ein Widerspruch, den ich hier nicht auflösen kann. Sie passen nicht zu den IMO-Zahlen (1,3 Mio. t) und allen anderen mir bekannten Quellen.
Nachtrag 27. März 2025: Shell hat auf meine Anfrage hin geantwortet, dass sie an ihrer Darstellung festhalten. Es handele sich um Daten von Clarkson´s 🔗 . Zu den davon stark abweichenden IMO-Zahlen oder zur Sache selbst wollte sich Shell nicht äußern.
LNG-Tanker sind nach wie vor die mit Abstand größten Verbraucher von LNG-Kraftstoffen. In den großen LNG-Tanks der Schiffe entsteht laufend Boil-Off-Gas (BOG), also Erdgas, das vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Die Schiffe nutzen dann dieses Gas als Fuel für ihre Motoren. Sie „tanken“ also während der Fahrt ihren Kraftstoff aus ihrer Fracht auf. Daher tauchen sie in der Statistik für Bunker Fuels (gelieferte Schiffstreibstoffe) nicht auf.
Die erwähnte Treibstoffmenge von 13 Mio. Tonnen stellte im Jahr 2023 etwa 6 Prozent des gesamten Kraftstoffbedarfs der Seeschifffahrt dar. Der Rest entfällt fast ausschließlich auf fossiles Öl, also diverse Typen von Fuel Oil und Schiffsdiesel.
Andere Kraftstoffe spielen nur eine geringe Rolle. Laut IMO 🔗 entfielen 2023 nur
- 0,4 Mio. t auf Biokraftstoffe (Biofuels)
- 0,25 Mio. t auf LPG (Propan, Butan) und
- 0,1 Mio. t auf Methanol
Vor allem die Biofuels haben als Beimischungen seit 2023 allerdings deutlich zugelegt, während es bei Methanol bisher nur sehr langsam vorangeht. Auch die ersten Schiffe mit Ammoniakantrieb 🔗 sind unterwegs, stellen aber noch eine exotische Ausnahme dar.
Unter den Seeschiffen, die alternative Kraftstoffe nutzen bzw. nutzen können (Dual Fuel), belegt LNG mit großem Abstand den Spitzenplatz. Die letzte Orderstatistik 🔗 zeigt das überdeutlich: Von den 34 großen Seeschiffen mit alternativen Antriebsoptionen, die im Februar 2025 in Auftrag gegeben wurden, sind 33 für LNG vorgesehen. Nur ein Schiff soll auch Ammoniak nutzen können.
Alle Analysen sind sich im Moment einig, dass die LNG-Mengen für Schiffsantriebe in den nächsten Jahren stark steigen werden. Einschränkend muss man jedoch hinzufügen, dass die Gaspreise langfristig kaum vorhersehbar sind. Ein steiler Anstieg der LNG-Preise könnte die aktuellen Prognosen rasch obsolet machen. Umgekehrt könnten niedrige Preise den Trend beschleunigen.
In Sicht: 2000 große Seeschiffe mit LNG-Antrieb
Der wichtigste Grund für den vermutlich berechtigten Optimismus liegt vor allem in der steigenden Zahl von Schiffen, die LNG einsetzen können.
- DNV 🔗 zählt aktuell 689 Seeschiffe (ohne LNG-Tanker), die mit LNG fahren können. Darunter sind vor allem Containerschiffe (u.a. auch von der deutschen Hapag-Lloyd 🔗 ). Aber auch in vielen anderen Schiffskategorien gibt es bereits Schiffe, die LNG als Fuel verwenden. Darunter sind z.B. auch Kreuzfahrtschiffe (u.a. Aida Cruises 🔗 ).
- Weitere 182 Schiffe mit LNG-Antrieb sollen allein in diesem Jahr hinzukommen.
- Zusätzliche 631 Seeschiffe mit LNG-Antrieb sollen bis zum Jahr 2033 fertiggestellt werden.
- Hinzu kommt noch die steigende Zahl von LNG-Tankern, die LNG als Fracht in alle Welt befördern und LNG als Fuel verwenden. Diese Flotte umfasst derzeit ca. 700 Schiffe.
Der weltgrößte LNG-Händler Shell und andere Akteure erwarten daher wohl zurecht, dass die Zahl der Seeschiffe, die LNG als Kraftstoff einsetzen können (inkl. Dual-Fuel) bis Ende dieses Jahrzehnts auf über 2000 Schiffe steigen wird.
Bis zum Jahr 2030 könnte der Verbrauch von LNG als Shipping Fuel daher rasch auf über 20 Mio. Tonnen LNG steigen.
Eine Menge von 20 Mio. Tonnen LNG ersetzt ca. 22 Mio.t Schiffsdiesel (HFO/MGO-Mix). Das sind 440.000 b/d (Barrel Öl pro Tag). Aktuell werden in der Seeschifffahrt ca. 4,4 mb/d Kraftstoffe aller Art verbraucht. LNG hätte dann also einen Marktanteil von 10 Prozent oder mehr, falls der Kraftstoffverbrauch des globalen Seeverkehrs bis 2030 ungefähr auf dem heutigen Niveau bleibt.
Sogar im Kontext des globalen Ölmarkts ist diese Menge relevant. Weltweit werden derzeit 102 mb/d (Mio. Barrel pro Tag) verbraucht. In diesem Jahr soll der Verbrauch um 0,8 mb/d steigen. Fossiles LNG spielt also bereits eine relevante Rolle als Ersatz für fossiles Öl, vor allem wenn man auch noch die steigende Zahl von Lkw mit LNG-Motoren addiert.
Fazit: Volle Fahrt voraus in die klimapolitische Sackgasse
Der Trend Richtung LNG ist klimapolitisch von großer Relevanz, da Methan zwar bei der Verbrennung etwa 25 Prozent weniger CO2 erzeugt als Schiffsdiesel, aber dafür andere Emissionen erzeugt.
Vor allem kann Methan in den Schiffsmotoren nicht vollständig verbrannt werden. Es entstehen Methanemissionen, die in den bislang weit verbreiteten Viertaktmotoren häufig über 3 Prozent der Treibstoffmenge liegen. Nur in langsam laufenden, modernen Zweitaktmotoren kann der Methanschlupf anscheinend auf unter 1 Prozent reduziert werden. Die Spannbreite zwischen den Schiffen ist allerdings je nach Geschwindigkeit und Technik sehr hoch und reicht von 0,8 Prozent bis über 10 Prozent Methanschlupf.
Die Klimaschäden sind also in vielen Fällen beträchtlich, da 1 Tonne Methan je nach Betrachtungszeitraum 29,8 Mal schädlicher (Zeithorizont 100 Jahre) oder 82,5 Mal schädlicher (20 Jahre) ist als 1 Tonne CO2. Der Vorteil gegenüber Diesel oder Fuel Oil bei der direkten Verbrennung kann sich daher schon bei geringen Methanemissionen während der Fahrt in einen Klima-Nachteil verwandeln (vgl. Anmerkung unten).
Hinzu kommen die Methanemissionen, die Upstream, also bei der Förderung und Aufbereitung von Erdgas entstehen. Sie sind allerdings bei der Ölproduktion noch höher.
Diese Probleme machen klar, dass der LNG-Pfad bei Schiffsantrieben in einer Sackgasse endet, da es sich wie bei Ölprodukten um einem fossilen Pfad handelt. Selbst wenn es gelingen sollte, den Methanschlupf in den Schiffsmotoren und die Emissionen bei der Erdgasproduktion zu minimieren, ist das Potenzial zur CO2-Einsparung begrenzt. Selbst im optimalen Fall kann gegenüber konventionellem Schiffsdiesel nur 30 Prozent CO2 eingespart werden.
Trotzdem ist dieser Pfad für die Reeder attraktiv, da die Emissions- und Kraftstoffanforderungen der EU und auch der IMO damit bis weit in die 2030er Jahre hinein erfüllt werden können.
Aber was kommt danach? Wenn die Schifffahrt eine stärkere Dekarbonisierung erreichen will, hat sie ab 2035 nur zwei Optionen:
- Entweder gelingt es, fossiles LNG in größerem Umfang durch Bio-LNG (aus Biomethan/Biogas) oder E-Methane (aus Grünem/Blauem Wasserstoff plus CO2) zu ersetzen – doch dafür sind die notwendigen Mengen nicht einmal ansatzweise in Sicht
- Oder sie muss eine Kehrtwende vollführen: Low-Carbon Ammoniak gilt derzeit als wahrscheinlichster Kandidat. Für kleine und mittelgroße Schiffe könnten Batteriestrom oder Grüner Wasserstoff die neuen Shipping Fuels werden.
Im April werden von der IMO wegweisende Entscheidungen für die Dekarbonisierung der Seeschifffahrt erwartet 🔗 . Die Erwartungen sind allerdings nicht sehr hoch. Im Moment sieht es danach aus, dass sich LNG als Kraftstoff im Seeverkehr weiter durchsetzen wird.
Anmerkung:
Weiterführende Informationen zum Thema Methanemissionen finden Sie in meinem Bericht für die DUH:
Methanemissionen in deutschen Erdgas-Lieferketten 🔗
Foto: © Hapag-Lloyd Group Mediathek. Es zeigt die Annäherung eines LNG-Feederschiffs (LNG Bunker Vessel) an die Hamburg Express
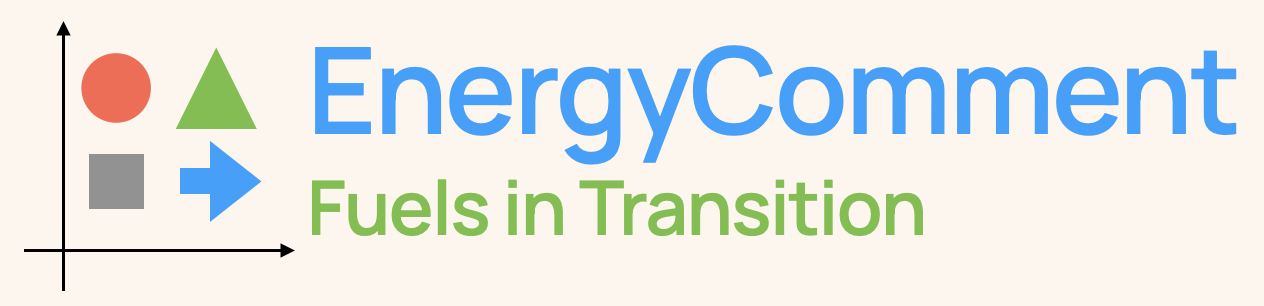

Schreibe einen Kommentar